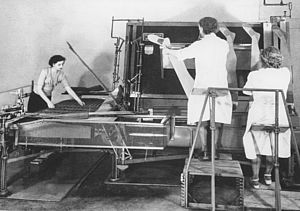Ein Jahr später wird der Ziegeleibetrieb durch den Ingenieur Jens Jürgen Paulsen aus Hamburg-Bergedorf übernommen. Paulsen hatte bereits verschiedene Niederlassungen von Ziegeleien, 1907 war er Direktor der Brunsbütteler Land- und Ziegelei-Gesellschaft. Als Betriebsleiter holte er im April 1904 den Ziegelmeister August Stahlmann (* 03.09.1863 in Lage / Lippe), zwei Jahre später folgte diesem Karl Hetzschold (* 23.12.1870 in Frauenprießnitz / Apolda) als Inspektor aus Straußfurt / Weißensee auf die Ziegelei.
Paulsen ertüchtigte die Ziegelei mit großem Elan. Er begann zunächst damit, einen neuen Ringofen anzulegen zu lassen. Dabei griff er auf das Know-how des Ziegeleibesitzers Hermann Günther aus Bergedorf zurück, der die Baupläne erstellt. Dann erweiterte er die Trockenschuppen, friedete das Gelände mit einer Mauer ein und schaffte von der Holmer Straße gleich drei Auffahrten auf das Gelände. Es wurde eine Schmiede und eine Tischlerwerkstatt an ein bestehendes Gebäude angebaut, zwei Packschuppen und weitere Ziegelschuppen wurden errichtet. Auch die Arbeiterschlafräume wurden erweitert, indem er auf dem Wohn- und Comptoirgebäude eine weitere Etage aufsetzte.
Auch außerhalb der Ziegelei wurde er aktiv und suchte nach besseren Transportmöglichkeiten für den Ton. Das stieß nicht auf Gegenliebe. So beschwerte sich im Juli 1905 der Grundeigentümer eines Wiesenstückes in der Marsch, Johann Jochim Ellerbrock aus Rissen, darüber, dass die Wedeler Dampfziegelei auf dem Wege von der Ziegelei nach der Marsch, auf dem sogen. Besenkoppeldamm ein Feldbahngleis gelegt hat, um darauf den Ton zu befördern. Hierdurch wäre nun der Weg zu eng und ein Ausweichen der Heu-Wagen nicht möglich. Bürgermeister Friedrich Eggers schaute sich das Terrain mit dem Wegeausschuss gemeinsam an und kam dann zu einer anderen Ansicht. Demnach wäre der Feldweg durchaus breit genug für zwei Fahrzeuge und zudem hätte Paulsen den bislang unbefestigten Weg eher befestigt. Die Wegebezeichnung Besenkoppeldamm ist heute nicht mehr zu finden. Da von Graben und Gebüsch die Rede ist, handelt es sich möglicherweise um den Feldweg, der von dem heutigen Hauenweg in die Marsch führt und keinen Namen führt.
1909 wurde ein Anbau an das Wohnhaus in Auftrag gegeben und der Wedeler Architekt Hermann Seebeck baute dem Ziegeleibesitzer ein „Sommerhaus“ an. Die Bauzeichnungen zeigen eine luftige Villa. Im Erdgeschoss wurde eine Wohnhalle mit Erker und Loggia neben einer Küche ausgeführt. Im Obergeschoss gab es neben dem Bad ein Schlafzimmer, ein Zimmer für die Großmutter und eines für den Sohn.
1910 lässt der Ziegeleibesitzer J.J. Paulsen die Stall- und Mannschaftsgebäude durch den Wedeler Baumeister J.P. Lüchau ausbauen. Es werden eine Küche, ein Speisesaal und weitere Kammern in dem alten Stallgebäude eingebaut.
Oktober 1910 erwirbt Paulsen an der Holmer Straße, genau neben seinem Grundstück weitere Parzellen und versieht auch dort das Gelände mit einer Einfriedigung. Als Pächter wird nun erstmals im August 1910 der bisherige Ziegeleiarbeiter Carl August Kirchhoff (* 03.12.1876 in Steinbründorf) genannt. Dieser war im April 1904 aus Kiel nach Wedel gereist, zwei Jahre später wieder nach Kiel zurückgegangen, um dann im März 1907 gemeinsam mit seiner Familie wieder nach Wedel zu kommen. Hier bekamen sie drei weitere Kinder. Der Inspektor Karl Hetzschold, der ab 1906 die Aufsicht über den Industriebetrieb hatte, ging zum 21.02.1911 zurück nach Reinbek.
Dann erweitert Paulsen sein Areal erneut, indem er Grundstücke auf dem der Holmer Straße gegenüberliegenden Gelände erwirbt. Der Bürgermeister Friedrich Eggers holt mit einem Schreiben vom 12.04.1912 die Einwilligung der Regierung in Schleswig zu einem Landtausch nachträglich ein. Demnach „hat der Ziegeleibesitzer Jens Jürgen Paulsen aus Hamburg bei der Ziegelei umfangreiche Landkäufe getätigt, nun will er das Gelände abrunden. Dafür müssen Wegestrecken aufgehoben werden. Die Stadt erhält im Gegenzug einige Areale Flächen und eine seit Jahren erwünschte kürzere Wegeverbindung zu den Ihlenseeländeren, sowie eine weitere Parzelle Land“. Der Weg gegenüber der Ziegelei an der Holmer Chaussee – der Ennbargweg, welcher als Zuwegung zu der Parzelle von Paulsen geht, wurde auf Antrag des Eigentümers nun als öffentlicher Weg aufgehoben, der Verlauf des Weges verschoben.